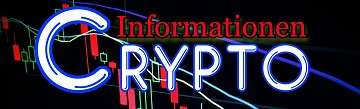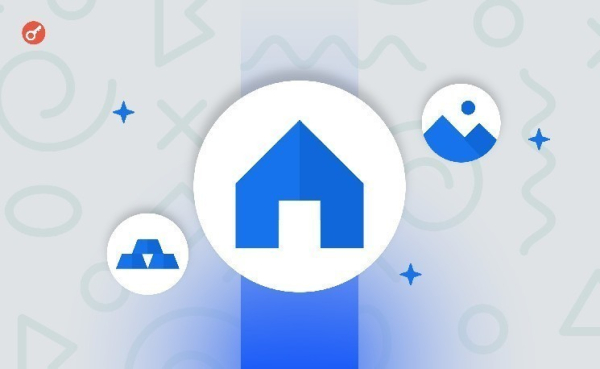Wie Rentner und Beamte auf den digitalen Rubel umsteigen und was an der Initiative falsch ist

Am 1. Oktober 2025 beginnt in Russland eine neue Phase der Einführung des digitalen Rubels – der nationalen digitalen Währung der Zentralbank. Das neue Instrument wird massenhaft eingesetzt: Es wird zur Auszahlung von Renten und Sozialleistungen verwendet.
BeInCrypto sprach mit Marktexperten, um herauszufinden, warum Rentner und Angestellte im öffentlichen Dienst als Erste gegen den digitalen Rubel (CBDC) ankämpfen mussten.
Was ändert sich ab 1. Oktober?
Die genaue Liste der Empfänger hat die Regierung noch nicht bekannt gegeben, doch schon jetzt steht fest: Die Änderung betrifft vor allem die Leistungen des Bundes. Dazu gehören Mutterschaftsgeld, einmaliges Geburtsgeld, monatliche Zahlungen bis zu 18 Monaten sowie Unterstützung für Familien mit geringem Einkommen, Behinderte, Arbeitslose und Rentner. Auch Mitarbeiter von Bundeseinrichtungen – von Ministerien und Behörden bis hin zu Museen und Theatern – könnten künftig Anspruch haben.
Die Bürger haben weiterhin die Wahl, ihr Geld in traditionellen Rubeln oder in digitalen Währungen zu erhalten. Um das neue Format auszuprobieren, müssen Sie einen Antrag bei der Bank einreichen und ein spezielles Konto eröffnen. Dieses Konto wird nicht offiziell bei der Bank geführt. Transaktionen mit dem digitalen Rubel werden direkt im System der Zentralbank erfasst, und die traditionelle Bank fungiert lediglich als Betreiber.
Die mobile App verfügt über eine separate „digitale Geldbörse“, von der aus Sie Geld auf Ihr reguläres Konto oder direkt an andere Nutzer digitaler Rubel überweisen können. Überweisungen zwischen diesen Geldbörsen sind kostenlos. Verfügt der Empfänger nicht über eine solche Geldbörse, muss die Überweisung über ein reguläres Konto erfolgen, wofür Gebühren anfallen können.
Die Entwicklungsphasen des digitalen Rubels werden in einem separaten Bericht ausführlicher behandelt.
Auf dem Weg des „FRIEDENS“
Das Mir-Zahlungssystem entstand 2014 nach der Verhängung westlicher Sanktionen und der Trennung mehrerer russischer Banken von Visa und Mastercard. Im März desselben Jahres stellten internationale Systeme die Abwicklung von Transaktionen der Rossiya Bank, der SMP Bank und der Investkapitalbank ein. Diese Episode gab den Anstoß für den beschleunigten Aufbau eines nationalen, von ausländischen Akteuren unabhängigen Systems.
Die Tests begannen mit Pilotprojekten in Regierungsbehörden: Die ersten Mir-Karten wurden an Beamte und Rentner ausgegeben. Nach und nach wurde das System auf große Banken und Einzelhandelsketten ausgeweitet. Um die Einführung zu beschleunigen, machte die Regierung die Kartenausgabe für alle Haushaltszahlungen, einschließlich Gehältern von Beamten, Sozialleistungen und Renten, obligatorisch.
Im Jahr 2022 stellten Visa und Mastercard nach dem Beginn einer speziellen Militäroperation und der Verhängung umfassender Sanktionen ihre Geschäftstätigkeit in Russland vollständig ein und zogen sich vom Markt zurück. Seitdem sind Mir-Karten praktisch das einzige nationale Zahlungsmittel für das inländische Bankgeschäft.
Lesen Sie auch: Warum die USA auf ein CBDC-Verbot zusteuern, während Russland im Gegenteil die Einführung eines digitalen Rubels anstrebt
Expertenmeinungen
Die Redaktion von BeInCrypto fragte Marktexperten, warum Rentner als erste mit dem digitalen Rubel vertraut gemacht werden sollten. Unsere Interviewpartner teilten unterschiedliche Perspektiven.
Zwischen Vertrauen und der „Währung des Zwangs“
Sean Young, Chefanalyst der Kryptobörse MEXC, hält den Übergang vom Konzept zur Praxis für logisch. Die Zielgruppe – Rentner und Leistungsempfänger – sei sowohl bequem als auch anfällig. Laut Sean Young seien diese Gruppen vollständig vom Budget abhängig, sodass die Regierung das System zentral testen könne. Für die Bürger selbst könne der Übergang jedoch belastend sein: Geringe digitale Kompetenz, technische Störungen und das Betrugsrisiko könnten zu Misstrauen führen.
Im besten Fall werde der digitale Rubel, so der Experte, zu einem Instrument zur Erhöhung der Transparenz von Transaktionen, im schlimmsten Fall werde er sich als „Zwangswährung“ etablieren.
Digitale Kluft und Schwachstellen
Alexey Karpunin, CIO und Gründer der IPWK IT Management Academy , wies darauf hin, dass Sozialleistungen hinsichtlich Höhe und Zeitpunkt vorhersehbar seien und sich daher gut testen ließen. Er sieht jedoch drei Hauptrisiken:
- digitale Kluft zwischen den Generationen;
- Infrastrukturbeschränkungen in den Regionen;
- Anfälligkeit für betrügerische Machenschaften.
Laut Alexey Karpunin ist ein Erfolg nur mit einem freiwilligen Übergang, einer vereinfachten Schnittstelle und zuverlässigem Datenschutz möglich.
Kontrolle und materielle Anreize
Alexander Peresichan, CEO von Tehnobit , betont die Kontrollfunktion des digitalen Rubels. Er erklärt, dass die Einführung des Systems über Sozialleistungen und Renten nicht nur einen Test des Systems, sondern auch eine maximale Abdeckung ermöglicht.
Unser Interviewpartner glaubt, dass konkrete Anreize – Rabatte oder Cashbacks auf Dienstleistungen und Bußgelder – eingeführt werden, um die Bürger zu ermutigen, wie es zuvor bei Gosuslugi und dem Faster Payments-System der Fall war. Er glaubt, dass der digitale Rubel auch bei öffentlichen Beschaffungen eingesetzt werden könnte, um Transparenz in der Ausgabenkette zu gewährleisten.
Eine Prüfung für den Staat und Herausforderungen für die Banken
Denis Balashov, CEO von SkyCapital , äußerte sich deutlicher. Der Experte bezeichnete den digitalen Rubel-Test für Rentner als „eine Prüfung für den Staat“. Er wies darauf hin, dass viele ältere Menschen noch Tastenhandys hätten und die Umstellung auf eine mobile Geldbörse verheerende Folgen haben könnte: Ausfälle oder eingefrorene Zahlungen würden Panik auslösen.
Denis Balaschow betont auch die Risiken einer übermäßigen Kontrolle: Der digitale Rubel, so Balaschow, könne sich letztlich zu „Geld an der Leine“ entwickeln. Das bedeutet, dass der Staat die Ausgaben begrenzen kann, indem er das Geld für bestimmte Zwecke „färbt“.
Es gibt noch einen weiteren wichtigen Faktor. Laut Denis Balaschow wird der digitale Rubel das traditionelle Gleichgewicht zwischen der Zentralbank und den Geschäftsbanken verändern. Wenn Gelder direkt in die Wallets der Zentralbank eingezahlt werden, verlieren die Banken den Zufluss kostengünstiger Gelder, der zuvor auf die Einlagen und Konten der Kunden floss. Um dieses Defizit auszugleichen, könnten Kreditinstitute ihre Zinssätze und Gebühren erhöhen, was sich direkt auf alle Bürger auswirken würde, auch auf diejenigen, die den digitalen Rubel nicht nutzen.
Verläuft das Projekt reibungslos, wird der digitale Rubel zu einem gängigen Zahlungsmittel: Rentner und Leistungsempfänger können problemlos Versorgungsleistungen oder Medikamente bezahlen, und die Regierung beweist die Zuverlässigkeit der neuen Währung. Sollten jedoch Störungen auftreten und sich Gerüchte über „kontrolliertes Geld“ verdichten, wird das Vertrauen in das Instrument untergraben und das Bankensystem vor neue Herausforderungen gestellt.
Ein logischer Schritt, aber vieles hängt vom Vertrauen ab
Finanzexperte Alexander Rjabinin sieht die Initiative neutral. Er betonte, Rentner und Leistungsempfänger seien ein logisches Testziel: Ihre Finanzströme seien stabil und vorhersehbar, sodass die Risiken für die Wirtschaft minimal seien. Er identifizierte drei Herausforderungen:
- digitale Kompetenz;
- Cybersicherheit;
- Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Privatsphäre.
Laut Alexander Ryabinin wird der digitale Rubel im Erfolgsfall zu einem praktischen und sicheren Instrument und zur Grundlage für die Implementierung von „Smart Contracts“ im sozialen Zahlungsverkehr. Im Misserfolgsfall besteht die Gefahr, dass er ein unpopuläres und wenig genutztes Projekt bleibt.
Der digitale Rubel als Nischeninstrument für Haushaltszahlungen
Fjodor Iwanow, Direktor für AML/KYT-Analyse bei Shard, merkte an, dass die Wahl von Rentnern und Begünstigten als erste Empfänger des digitalen Rubels nicht nur durch den großen Umfang dieser Zahlungen, sondern auch durch deren Herkunft erklärt wird. Diese Bürgerkategorien erhalten die Mittel direkt aus dem Haushalt, was bedeutet, dass das System auf der kürzesten und überschaubarsten Kette getestet wird: von den Staatskonten bis zum Endempfänger.
Laut Fjodor Iwanow reduziert dieser Ansatz die rechtlichen und technischen Risiken und bestätigt die Aussage der Zentralbank, dass es keine „erzwungene Umstellung des gesamten Landes“ auf den digitalen Rubel geben werde.
Der Experte betont, dass ein digitaler Rubel, der vollständig von der Zentralbank kontrolliert wird und ohne Beteiligung von Geschäftsbanken funktioniert, zusätzliche Möglichkeiten zur Transaktionsüberwachung eröffnet. Insbesondere könnte er die Untersuchung mutmaßlicher Verstöße beschleunigen.
Fjodor Iwanow äußert jedoch auch Bedenken: Die flächendeckende Einführung des digitalen Rubels könnte die Rentabilität des Bankensektors, insbesondere für kleinere Akteure, verringern, was sich letztlich negativ auf das gesamte Bankensystem auswirken könnte.
Infolgedessen wird der digitale Rubel laut Fjodor Iwanow wahrscheinlich ein Nischeninstrument bleiben, das in erster Linie für Haushaltszahlungen und die Teilnahme an staatlichen Verträgen gedacht ist. Seine Verwendung im Privatkundenbereich kann jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden: Unternehmen werden Geld an Bürger überweisen, und diese Gelder werden in digitale Geldbörsen eingezahlt. Wie der Experte anmerkt, ist genau dieser Aspekt derzeit im Rahmen des Pilotprojekts untersucht.
Schlussfolgerungen
Die Einführung eines digitalen Rubels über Sozialleistungen ist ein pragmatischer und riskanter Schritt. Einerseits erhält die Regierung die Möglichkeit, die neue Technologie unter streng kontrollierten Bedingungen zu testen und die Vorteile der Transparenz zu demonstrieren. Andererseits sind die ersten Nutzer – Rentner und Leistungsempfänger – am wenigsten auf komplexe digitale Innovationen vorbereitet. Jede Panne oder Unannehmlichkeit könnte Misstrauen schüren und eine anhaltend negative Einstellung hervorrufen.
Der Erfolg des Projekts hängt nicht von der Technologie selbst, sondern vom Vertrauen der Bevölkerung ab. Erweist sich der digitale Rubel als praktisch, sicher und auch für ältere Menschen zugänglich, wird er sich nach und nach neben der Mir-Karte und dem Schnellzahlungssystem zu einem gängigen Instrument entwickeln. Ist er jedoch mit Zwang, Störungen oder übermäßiger Kontrolle verbunden, droht die neue Geldform an den Rand gedrängt zu werden, und der Staat wird am Ende ein weiteres Beispiel für die Digitalisierung „für die Akten“ und nicht für die Bevölkerung haben.
Man kann mit Sicherheit sagen, dass der digitale Rubel im Herbst 2025 seine größte Bewährungsprobe bestehen wird. Und die Wahrnehmung seiner ersten Nutzer wird darüber entscheiden, ob er zu einem Symbol der finanziellen Zukunft wird oder zu einer weiteren Erinnerung daran, dass nicht jede Innovation das Leben einfacher macht.
Source: cryptonews.net